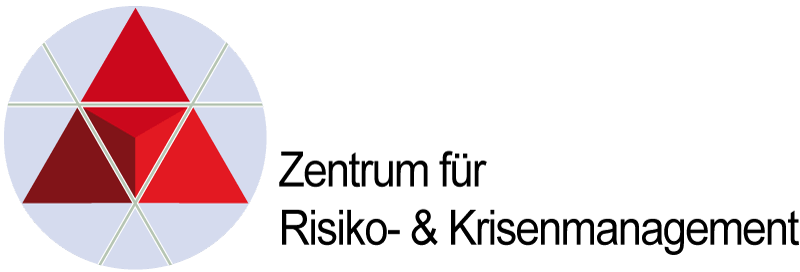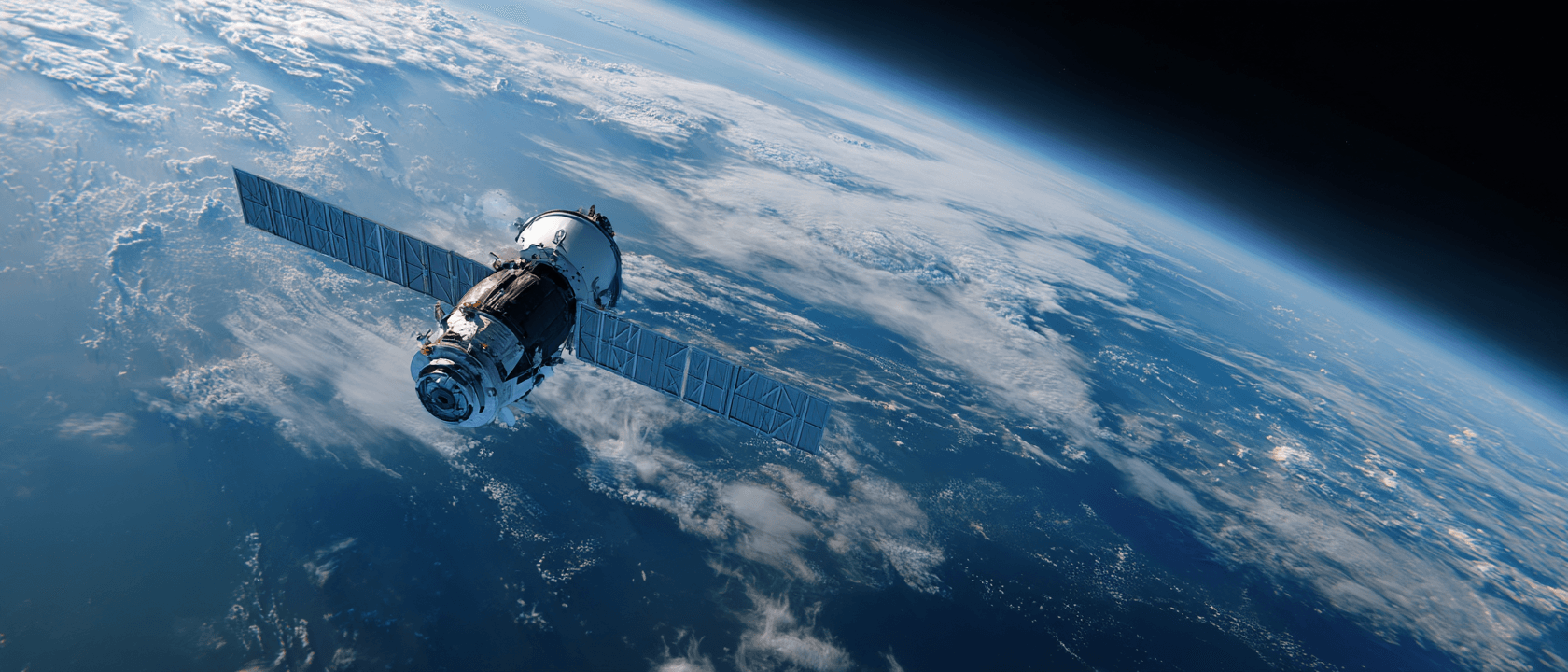
Die Low Earth Orbit Economy (LEO-Economy) – wirtschaftliche Aktivitäten in 160 bis 2.000 Kilometern Höhe – entwickelt sich zu einem der dynamischsten Zukunftsmärkte. Laut einer aktuellen Studie von Roland Berger und LEOconomy könnte sie bis 2040 über eine Billion Euro zur globalen Wertschöpfung beitragen.
Angetrieben wird dieses Wachstum von technologischen Fortschritten in der Raumfahrt und den politischen Ambitionen führender Nationen wie den USA und China. LEO-Anwendungen versprechen tiefgreifende Veränderungen für traditionelle Industrien – von Telekommunikation und Energie über Landwirtschaft und Logistik bis hin zu Medizin und Materialforschung. Ein besonderer Vorteil: In der Mikrogravitation lassen sich Experimente und Produktionen durchführen, die auf der Erde unmöglich sind, wie etwa die Entwicklung neuer Materialien oder hochreiner Arzneimittel.
Für Europa hat der Ausbau der LEO-Economy strategische Bedeutung: Weniger Abhängigkeit von außereuropäischen Akteuren, Stärkung der technologischen Souveränität und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Studie nennt drei Kernvoraussetzungen: politische Unterstützung mit klaren Regulierungen und Standards, finanzielle Förderung durch staatliche und private Investoren sowie gezielte technologische Entwicklung.
Politische Unterstützung umfasst klare Regeln zu Eigentums- und Nutzungsrechten, Sicherheit und Datenverarbeitung im Orbit. Finanzielle Förderung sollte neben staatlichen Programmen auch öffentlich-private Partnerschaften und neue Finanzinstrumente beinhalten. Technologisch sind vor allem Fertigung im Orbit, Wartungsrobotik und nachhaltige Energielösungen entscheidend.
Die Studie identifiziert vier zentrale Anwendungsfelder der LEO-Economy:
-
Infrastruktur im Orbit
Bau und Betrieb von Raumfahrzeugen, Errichtung logistischer Knotenpunkte, Datenlagerung im All zur Reduzierung des Energieverbrauchs auf der Erde. -
Dienstleistungen im All
Nutzung der Mikrogravitation für Forschung, Materialentwicklung und pharmazeutische Anwendungen. Der Markt für pharmazeutische Mikrogravitation wird auf rund 30 Milliarden Euro geschätzt. -
Weltraumfertigung
Produktion von Halbleiterkristallen und innovativen Proteinen im All, die auf der Erde nicht herstellbar sind. -
Technologie-Spin-offs
Übertragung von Weltraumtechnologien in irdische Anwendungen, etwa in den Bereichen Umwelttechnik, Robotik oder neue Werkstoffe.
Um das Potenzial der LEO-Economy auszuschöpfen, sind langfristige, koordinierte Initiativen notwendig. Regulierungsbehörden und Raumfahrtexperten müssen Richtlinien entwickeln, die Wachstum fördern und zugleich Sicherheit sowie Nachhaltigkeit gewährleisten. Internationale Normen können zudem die globale Kooperation erleichtern.
Die Kapitalbereitstellung durch Banken, Investoren und öffentliche Stellen ist entscheidend. Forschung und Entwicklung in Raumfahrt- und Nicht-Raumfahrtindustrien müssen gezielt in Schlüsseltechnologien investieren, wobei konkrete Märkte und Anwendungsfälle identifiziert werden sollten. Industrieunternehmen und Raumfahrtbranche sollten in Pilotprojekten die Integration von Weltraumtechnologien in bestehende Geschäftsmodelle testen.
Auch Bildung spielt eine wichtige Rolle: Universitäten und Forschungseinrichtungen können durch spezialisierte Programme Fachkräfte für diese Zukunftsbranche ausbilden und gleichzeitig Grundlagenforschung betreiben.
Europa muss in der Low Earth Orbit Economy eine aktive Rolle einnehmen. Der Ausbau ist entscheidend für wirtschaftliches Wachstum, technologische Innovationskraft, Klimaschutz und strategische Unabhängigkeit. Der Wirtschaftsraum Weltall geht weit über die Raumfahrtindustrie hinaus und betrifft zahlreiche Branchen, die von den dort entstehenden Technologien profitieren können.
Die Low Earth Orbit Economy steht am Beginn einer rasanten Entwicklung, vergleichbar mit der Internet-Ökonomie in den 1990er-Jahren. Europa hat jetzt die Möglichkeit, eine führende Rolle einzunehmen – vorausgesetzt, politische, finanzielle und technologische Hürden werden rechtzeitig überwunden.