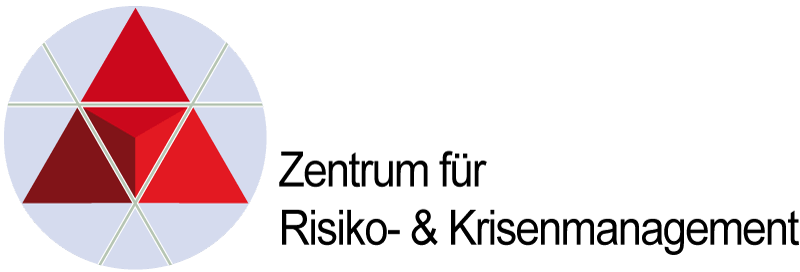Genchirurgie mit Vorhersagekraft
Ein Forschungsteam der Universität Zürich hat eine neue Methode vorgestellt, mit der sich genetische Eingriffe deutlich präziser vorhersagen und steuern lassen. Die als „Pythia“ bezeichnete Technologie kombiniert die bewährte Genschere CRISPR-Cas9 mit künstlicher Intelligenz (KI) und soll künftig helfen, unerwünschte genetische Nebeneffekte zu vermeiden.
Das Team um Soeren Lienkamp vom Institut für Anatomie präsentierte seine Ergebnisse diese Woche in der renommierten Fachzeitschrift Nature Biotechnology. Die Innovation gilt als vielversprechender Fortschritt im Bereich der molekularen Medizin, mit potenziellen Anwendungen in der Forschung, Diagnostik und Gentherapie.
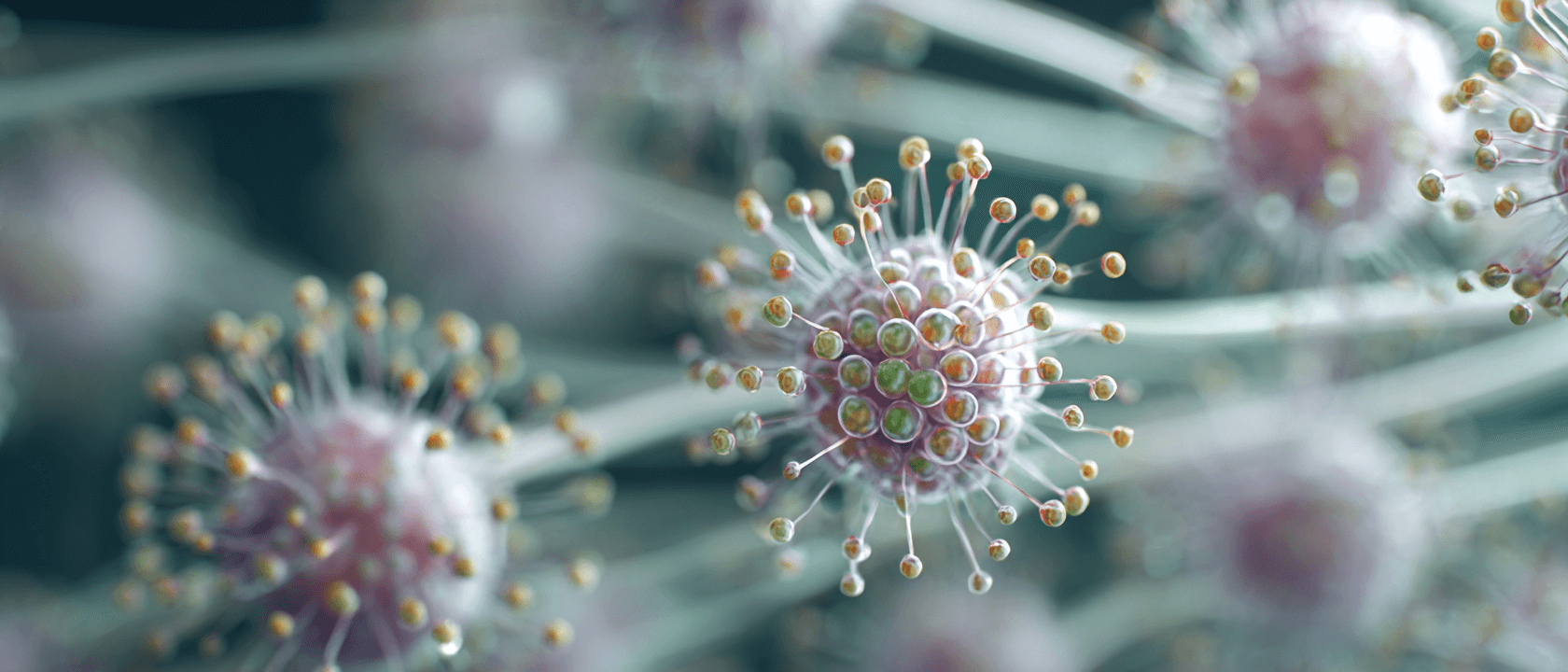
Die Herausforderung bei CRISPR: Reparatur statt Schnitt
CRISPR-Cas9 gilt seit Jahren als das Werkzeug der Wahl für gezielte Genveränderungen. Die Methode funktioniert, indem sie einen gezielten Schnitt in der DNA vornimmt. Danach setzt jedoch der eigentliche kritische Prozess ein: Die Zelle beginnt, die beschädigte DNA zu reparieren – meist schnell, aber nicht unbedingt kontrolliert.
Die Schwierigkeit dabei: Obwohl bestimmte Reparaturmuster häufiger auftreten als andere, ist der Prozess nicht exakt vorhersehbar. Das kann dazu führen, dass benachbarte Gene unbeabsichtigt beschädigt oder wichtige regulatorische Sequenzen verändert werden. Besonders problematisch wird dies bei medizinischen Anwendungen, etwa bei Gentherapien, die höchste Präzision erfordern.
KI als Orakel: „Pythia“ prognostiziert Zellreaktionen
Hier kommt die neue Methode ins Spiel. „Pythia“, benannt nach der berühmten Priesterin des antiken Orakels von Delphi, soll vorhersagen, wie Zellen auf genetische Eingriffe reagieren, bevor diese überhaupt stattfinden. „So wie Meteorologen KI nutzen, um das Wetter vorherzusagen, nutzen wir es, um zu prognostizieren, wie Zellen mit der Genschere umgehen“, erklärt Studienleiter Lienkamp.
Dazu wurde ein KI-Modell trainiert, das auf bestehenden Genomdaten, Reparaturmustern und Versuchsergebnissen basiert. So kann „Pythia“ nicht nur den Reparaturverlauf antizipieren, sondern auch dabei helfen, die idealen Voraussetzungen für gewünschte Genveränderungen zu schaffen.
Reparaturschablonen als molekularer Klebstoff
Ein zentrales Element von „Pythia“ sind winzige, synthetisch entwickelte DNA-Schablonen, die gezielt in den Zellprozess eingeschleust werden. Diese fungieren wie eine Art molekularer Klebstoff: Sie „lenken“ die Zelle während der Reparaturphase und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass exakt die gewünschte Veränderung vorgenommen wird.
Die Schablonen wurden zunächst in menschlichen Zellkulturen getestet – mit Erfolg. Die Forscher konnten zeigen, dass sich auf diese Weise präzise Genveränderungen durchführen lassen, ohne die typischen „Nebenwirkungen“ wie unerwartete Mutationen oder Genverlust.
Tests an Mensch, Maus und tropischem Frosch
Um die Anwendbarkeit der Methode über Zellkulturen hinaus zu prüfen, testete das Team „Pythia“ auch an lebenden Organismen. Dabei kamen sowohl Mäuse als auch tropische Frösche zum Einsatz. In beiden Fällen konnte gezielt in Hirnzellen eingegriffen und genetisches Material verändert werden – etwa zur fluoreszierenden Markierung bestimmter Proteine.
Diese Markierungen dienen der biomedizinischen Forschung, um Zellprozesse besser sichtbar und nachvollziehbar zu machen – etwa bei der Entwicklung des Nervensystems oder bei der Untersuchung neurodegenerativer Erkrankungen.
Mögliche Anwendungen in Forschung und Medizin
Die neue Technologie könnte mittelfristig vielseitig einsetzbar sein: von der Grundlagenforschung über die Modellierung genetischer Erkrankungen bis hin zur Entwicklung zielgerichteter Gentherapien. Besonders relevant ist sie in Bereichen, in denen absolute Präzision entscheidend ist – etwa bei der Korrektur von Punktmutationen, der gezielten Ausschaltung krankheitsrelevanter Gene oder der kontrollierten Integration therapeutischer DNA.
Gleichzeitig bietet die Methode eine Art Sicherheitsnetz: Durch die Vorhersagekraft der KI lassen sich potenziell gefährliche Eingriffe bereits im Vorfeld erkennen und vermeiden.
KI macht Gentechnik präziser und sicherer
Mit “Pythia” gelingt der Zürcher Forschungsgruppe ein bedeutender Schritt zur Kontrolle genetischer Eingriffe. Die Kombination aus biotechnologischer Feinmechanik und datenbasierter Vorhersage durch KI eröffnet neue Perspektiven in der modernen Genchirurgie – sicherer, gezielter und breiter einsetzbar.
Auch wenn klinische Anwendungen noch ausstehen, ist der Weg geebnet: Gentechnologie wird dank KI berechenbarer – und damit eines Tages auch vertrauenswürdiger für den therapeutischen Einsatz am Menschen.