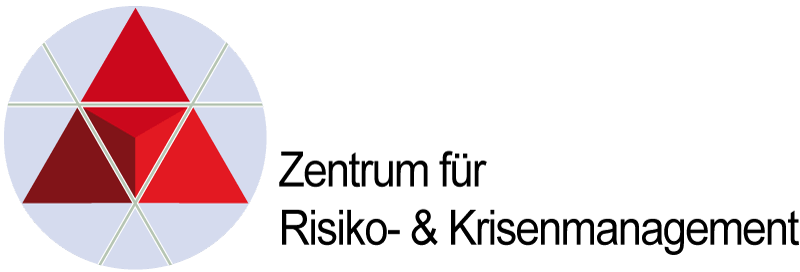Österreichs Satellitenpläne
Bis spätestens Anfang 2027 will das österreichische Bundesheer eigene Kleinsatelliten ins All bringen. Brigadier Friedrich Teichmann beschreibt die Geräte als etwa schuhkartongroß. Das Projekt verfolgt mehrere Ziele: Unabhängigkeit bei der Satellitennutzung, erweiterte Aufklärungsfähigkeiten und technologische Spitzenleistungen – insbesondere bei der Erkennung von GPS-Störsendern.
Teichmann, seit zehn Jahren im Bereich Weltraum tätig, arbeitet derzeit an zwei Projekten. Das größere ist eine Kooperation mit den niederländischen Streitkräften und umfasst vier Satelliten. Drei verbleiben in der Umlaufbahn, einer bleibt auf der Erde für Tests. Eine Hauptaufgabe: Störsignale aufspüren, die Navigationssysteme wie GPS beeinträchtigen. Diese Fähigkeit gilt als militärisch besonders wichtig, da exakte Navigation für Einsätze unverzichtbar ist.
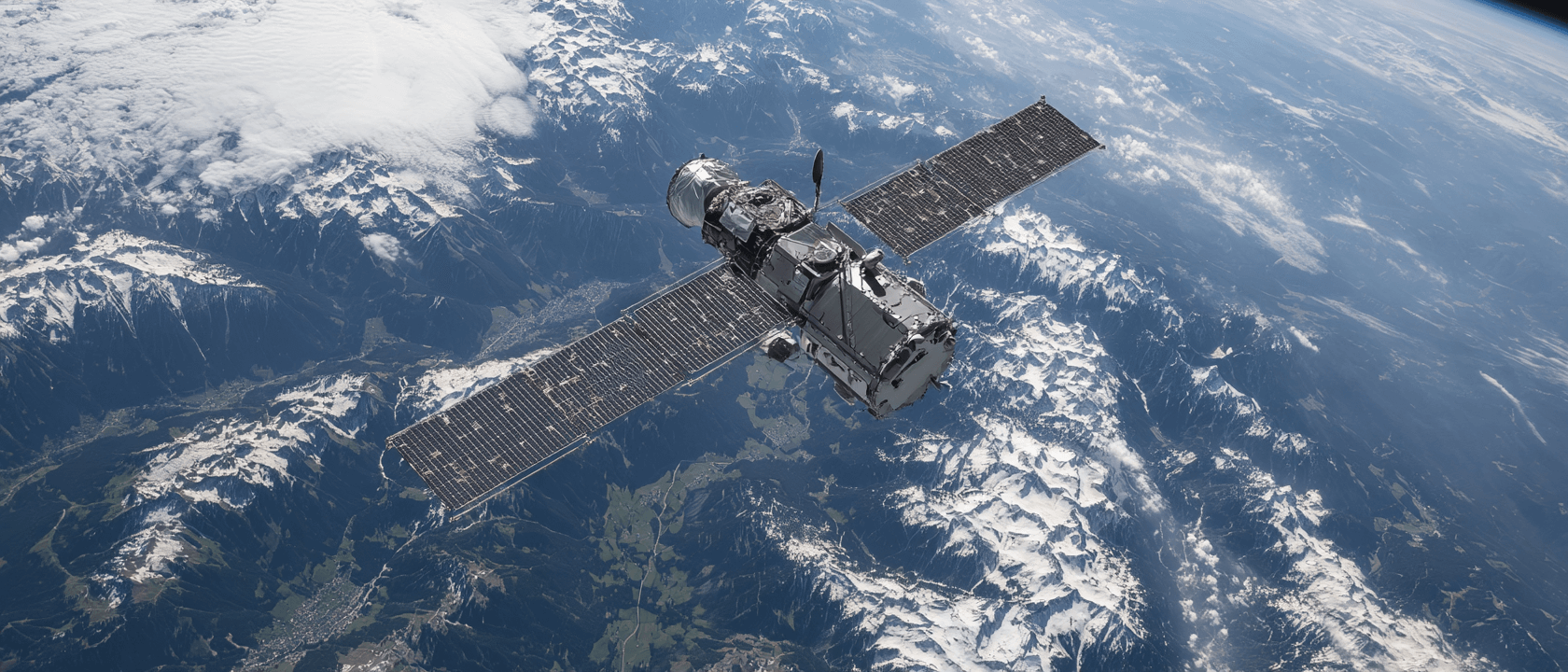
Satelliten mit doppeltem Nutzen
Neben der Störsendererkennung wird das System auch Bilddaten liefern. Zwar gibt es dafür bereits zivile Anbieter, doch der Eigenbetrieb bringt einen entscheidenden Vorteil: Manipulationen oder Verzögerungen Dritter lassen sich vermeiden. Teichmann betont, dass man so unabhängig werde und Bildmaterial selbst verifizieren könne – ein wichtiger Faktor angesichts der Möglichkeiten zur Bildmanipulation, etwa durch Künstliche Intelligenz.
Die geplanten Kameras der österreichisch-niederländischen Satelliten sollen Objekte ab einer Größe von rund drei Metern auflösen können. Fahrzeuge sind so identifizierbar, Menschen jedoch nicht.
Vorteile eigener Infrastruktur
Mit eigenen Satelliten will das Bundesheer Bildmaterial direkt aufnehmen, anstatt auf externe Quellen angewiesen zu sein. Teichmann erinnert daran, dass in der Vergangenheit Bilder aus fremden Quellen nicht immer überprüfbar waren. Zudem ermögliche der Eigenbetrieb schnellere Reaktionszeiten – wichtig bei zeitkritischen Einsätzen.
Die Satelliten werden in zwei Bahnhöhen operieren: rund 500 Kilometer für reguläre Umläufe und 200 bis 300 Kilometer für Detailaufnahmen. Dieses „LEO2VLEO“-Konzept (Low Earth Orbit to Very Low Earth Orbit) erlaubt flexibles Umschalten zwischen Übersicht und Detail.
Kosten und Umsetzung
Die Gesamtkosten betragen rund zehn Millionen Euro, davon sechs Millionen aus österreichischen Mitteln. Ein weiterer Satellit wird vom Bundesheer eigenständig finanziert und gebaut – kleiner, günstiger und ausschließlich von österreichischen Unternehmen gefertigt.
Der Betrieb der Hauptsatelliten wird gemeinsam mit den niederländischen Partnern erfolgen. Die Auswahl fiel laut Teichmann auf die Niederlande, weil beide Länder vergleichbare Größenordnungen im Militärbereich haben und Kooperationen auf Augenhöhe möglich seien.
Technische Herausforderungen
Der niedrigere Flug in 200 bis 300 Kilometern Höhe erlaubt zwar detailreiche Aufnahmen, bringt aber Herausforderungen mit sich: Satelliten in dieser Bahn unterliegen stärkerem Luftwiderstand und müssen regelmäßig ihre Umlaufbahn anpassen, was mehr Treibstoff erfordert. Langfristig verglühen sie, sobald sie zu tief in die Atmosphäre eintreten. Teichmann rechnet damit, dass dies nach drei bis fünf Jahren der Fall sein wird.
Politische Unterstützung und Zukunftspläne
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sieht in dem Projekt einen wichtigen Schritt zu mehr Resilienz und Unabhängigkeit des Bundesheeres. Österreich werde damit nicht länger nur Nutzer, sondern aktiver Gestalter im Orbit.
Teichmann arbeitet bereits an einem Nachfolgeprojekt für die erste Satellitengeneration. Dabei werden auch neue Partnerstaaten ins Auge gefasst. Langfristig könnte das Bundesheer auch in satellitengestützte Kommunikation einsteigen, eventuell durch den Kauf größerer Systeme, wie sie etwa Luxemburg betreibt.
Technologische Selbstständigkeit
Mit dem Aufbau eigener Satellitenkapazitäten will das Bundesheer technologische Selbstständigkeit und strategische Vorteile im All sichern. Die Kombination aus Störsendererkennung und eigener Bildaufklärung macht Österreich in einem Bereich handlungsfähig, der bisher vor allem großen Militärmächten vorbehalten war. Bis 2027 sollen die ersten Systeme betriebsbereit sein – ein Schritt, der das Bundesheer langfristig unabhängiger und flexibler machen könnte.